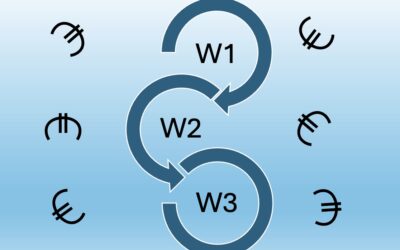Eigentlich sind sich alle einig: Karrierewege in der Wissenschaft müssen planbarer werden und das heißt vor allem, dass die Entscheidung über den dauerhaften Verbleib im System deutlich früher fallen muss. Aufgrund der großzügigen Befristungsoptionen, die über die Qualifizierungsbefristung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) sowie durch Drittmittelprojekte ermöglicht werden, ist es für die meisten Wissenschaftler*innen in Deutschland die Regel, über Jahrzehnte in Unsicherheit über ihre nächste Weiterbeschäftigung zu leben. Das eigentliche Normalarbeitsverhältnis – die unbefristete Vollzeitstelle – kommt meist erst mit dem Ruf auf eine Lebenszeitprofessur in Reichweite, also zu einem Zeitpunkt, wenn die betreffenden Personen (je nach Fachbereich) bereits das fünfte Lebensjahrzehnt erreicht haben. Hier noch von wissenschaftlichem ‚Nachwuchs‘ zu sprechen, wie es in der Debatte weiterhin gerne geschieht, ist angesichts dieser biografischen Hintergründe Spott und Hohn. Der aktuelle Zustand führt außerdem dazu, dass insbesondere Frauen aus der Wissenschaft ausscheiden, weil die Phase, in der die für die Entfristung relevanten Leistungen zu erbringen sind, mit der der Familiengründung zusammenfällt, was häufig eine Entscheidung für das eine oder das andere nötig macht.
Im Durchschnitt liegt das Erstberufungsalter auf eine W2-Professur bei 41,7, auf eine W3-Professur bei 43,2 Jahren (Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2021), variiert aber stark über die einzelnen Fachdisziplinen hinweg. Dort, wo eine starke Industriekonkurrenz oder anders zustande kommender ‚Nachwuchsmangel‘ herrscht und die Habilitation als Voraussetzung für die Berufbarkeit keine Rolle spielt, ist es nicht unwahrscheinlich, mit Mitte 30 eine W3-Professur auf Dauer zu erlangen. In Fächern mit Habilitation und dreistelligen Bewerberzahlen auf eine einzige Professur stellt sich im individuellen Einzelfall hingegen mitunter sogar die Frage, ob es überhaupt noch rechtzeitig vor der allgemeinen Altersgrenze von 52 Jahren zur Verbeamtung kommt.
Nicht nur wegen dieser enormen Streuung ist das Erstberufungsalter keine hilfreiche Größe, wenn es um die Diskussion über wissenschaftliche Karrierewege geht. Es führt eher dazu, dass sich die Debatte im Kreis dreht, immer dieselben (und daher erwartbaren) Argumente vorgebracht werden – und sich trotz des Bekenntnisses zu früherer Planbarkeit wenig ändert. Denn wenn man als Ziel die Senkung des Erstberufungsalters ausgibt (was zumindest auf dem Papier eigentlich niemand wirklich ernsthaft ablehnt), wird bei der Diskussion über konkrete Maßnahmen zu seiner Erreichung stets jemand feststellen, dass man dann im eigenen Fach Menschen auf Professuren berufen müsste, die gerade erst promoviert worden sind und kaum weitere eigene Forschungsleistungen mitbringen. Also wird man weiter argumentieren, dass es doch noch eine irgendwie geartete Bewährungsphase braucht, die in der Regel in der bisher üblichen Länge angesetzt wird.
Letztlich ist genau dieser Denkfehler auch bei der Debatte um die Reform des WissZeitVG und den vom FDP-geführten Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) vorgelegten Referentenentwurf zu beobachten: Wollte man ursprünglich die Höchstbefristungsdauer für Postdocs auf drei Jahre verkürzen, um eine frühere Entfristung zu erzwingen, ist man sich mit dem jetzigen Entwurf und der dortigen 4+2-Lösung zu der sechsjährigen Zeitspanne zurückgekehrt, die aktuell gilt. Freilich: Wenn die als notwendig empfundene zweite ‚Qualifikationsphase‘ im Kern genauso lang bleibt wie bisher, wird das Erstberufungsalter kaum sinken.
Die Frage ist allerdings, ob das überhaupt die entscheidende Marke sein sollte, um das dahinterliegende Ziel der Erhöhung der Planbarkeit zu erreichen. Das Problem, dass Wissenschaftler*innen auf ihrem Karriereweg haben, besteht schließlich weniger darin, dass sie erst im fortgeschrittenen Alter eine Professur bekommen, als in der jahrzehntelangen beruflichen Unsicherheit an sich. Weil das aktuelle System nun mit wenigen Ausnahmen nur die Professur als entfristeten Stellentyp kennt, konzentriert sich die Debatte konsequenterweise stark auf diese Art wissenschaftlicher Beschäftigung. Selbst die Stellungnahmen zur WissZeitVG-Reform – die eigentlich Dauerstellen neben und vor der Professur schaffen soll – lassen häufig erkennen, dass die Wissenschaftsverbände oft mehr oder weniger bewusst weiterhin die Berufbarkeit als Voraussetzung für eine Entfristung annehmen. Dies freilich läuft dem Ziel jeglicher Reformbemühungen zuwider und ist auch unlogisch: Warum soll jemand, der ohnehin keine Professur bekommen wird, trotzdem alle Voraussetzungen für diese erfüllen, sich also auf (Leitungs-)Aufgaben vorbereiten, die er nie übernehmen kann?
Deshalb gilt es die Personalstruktur in der Wissenschaft so umzugestalten, dass tatsächlich mehr unbefristete Stellen für das (nur) promovierte Personal entstehen. Dabei müssen so viel Flexibilität und Freiraum eingeplant werden, dass sich Menschen auf diesen Stellen weiterentwickeln und weiterbewerben können. Das immer noch häufig vorgebrachte Verstopfungsargument (Stellen, die einmal besetzt worden sind, bleiben 30 Jahre besetzt) gilt nämlich nur, wenn wir Wissenschaftler*innen mit Dauerstellen wie bisher weiter in berufliche Sackgassen führen. Auf Hochdeputatsstellen, wie sie z. T. als Lösungen für das konstatierte Problem eingeführt worden sind, wird kaum jemand habilitieren und von der unbefristeten LfbA-Stelle auf eine Professur wechseln. Genau das müsste aber passieren, damit Dauerstellen und systeminterne Stellenfluktuation zusammengehen.
Wenn wir dagegen Befristung und Weiterentwicklung entkoppeln, also Stellentypen schaffen, die zwar unbefristet sind, von denen sich Menschen nach vielleicht zehn Jahren aber doch wieder wegbewerben, weil sie eine attraktivere unbefristete Position (z. B. eine Professur) in Aussicht haben, werden diese Stellen nicht nur wieder frei. Überdies löst man auf diesem Weg das Problem, dass für die Berufung auf eine Professur weitere Erfahrungen notwendig sind, die entsprechend Zeit brauchen. Nur: Man zwingt eben nicht länger die Bewerber*innen, diesen Weg ohne jegliche Sicherheit zurückzulegen, weil es der einzige ist, der nicht zum Exit führt.
In einem solchen System ist das gegenwärtige Erstberufungsalter vielleicht aber nicht mehr zu hoch, sondern völlig angemessen. Zu hoch ist es nur, solange die Erstberufung weitgehend identisch mit der Entfristung und damit der Entstehung von Planbarkeit ist. Bildet es jedoch nur noch den Zeitpunkt ab, zu dem Menschen in der Wissenschaft Führungsverantwortung übernehmen, gibt es keinen wirklichen Grund, die Zahl senken zu wollen, zumal generell über alle Fachbereiche hinweg ohne Berücksichtigung der Fachunterschiede.
Das durchschnittliche Erstberufungsalter muss also nicht zwingend sinken. Sinken muss das Alter, in dem Menschen in der Wissenschaft in der Regel eine unbefristete Stelle erhalten – unabhängig davon, um welche Art von Stelle es sich handelt. Es ist wichtig, sich dieses eigentlich auch hinter der Forderung nach einer Senkung des Erstberufungsalters stehende Anliegen vor Augen zu halten und sich darüber klar zu werden, dass es anders (besser) zu erreichen ist. Der Fokus auf das Erstberufungsalter birgt letztlich zu sehr die Gefahr einer reinen Stellvertreterdebatte, die immer wieder zum Ausgangspunkt zurückführt. Diese haben jetzt oft genug geführt. Es wird Zeit, neue Wege beschreiten.